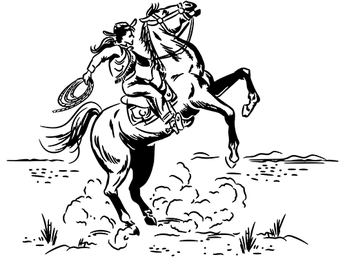Prärieblume
Prärie-Reihe: Band 2

Klappentext
Anne hat alles verloren. Völlig am Ende kämpft sie sich Stück für Stück zurück ins Leben und stolpert schließlich in die Welt einer wandernden Wild-West-Show. Ihr Ruf als feurige, zielsichere Revolverheldin eilt ihr schon bald voraus. Wären da nicht die Dämonen ihrer Vergangenheit - ihr Leben könnte perfekt sein. Doch dann ist da auch noch Kaulder, der sie nicht mehr loslässt. Und der hat zu allem Überfluss noch eine Verabredung mit dem Galgen.

Fakten
Verlag: Books on Demand
Genre: Roman (Western)
Sprache: Deutsch
Umfang: 244 Seiten
Erscheinungsdatum: 25.07.2018
ISBN-Nummer: 978-3-746-09902-6
Shoplinks
Und viele weitere Onlineshops wie z. B. Thalia, Hugendubel, etc.
Leseprobe
Kapitel 1: Zerflossen
Die Nacht war still. Endlich war es still. Kein Laut war mehr zu hören. Die Schwärze hatte alles verschlungen, nicht nur ihre Umgebung, sondern auch Anne selbst. Sie fühlte sich als wäre sie überhaupt nicht mehr hier. Nein - sie war nicht mehr hier. Alles, was von ihr noch übrig war, war ihre körperliche Hülle. Und bei Gott, sie hoffte mehr als inständig, dass diese bald ihr Ende fand.
Sie lehnte sich schwerfällig an die hölzerne Hundehütte und kümmerte sich nicht darum, dass ihre Hände vom Abstützen am Boden voller Staub waren. Es war Dreck, genauso wie sie selbst. Sandiger, erdiger Dreck. Schmutzig, das war sie jetzt. Für immer und ewig beschmutzt.
Möge die Ewigkeit möglichst kurz sein.
Anne hatte alles verloren. Alles. Und noch mehr. Alles, was ihr je wichtig gewesen war und auch den Rest hatten sie ihr genommen. John war tot. Ermordet. Kaltblütig ermordet. Das Bild seines erschrockenen, besorgten Blicks, als sie sich vor seinen Augen an ihr vergingen und ihm schließlich die Kehle aufschlitzten, hatte sich tief in ihr Gehirn eingebrannt.
Sie würde es nie wieder vergessen.
In diesem Moment war ihre gesamte Welt zu Staub zerfallen.
Es war ein grausamer, viel zu langsamer Tod gewesen. Kläglich war er an seinem eigenen Blut erstickt. Als würde es immer und immer wieder geschehen, sah sie seinen Todeskampf vor ihrem geistigen Auge. Die Blutlache, die langsam immer größer wurde. Und den Moment, als der Ausdruck aus seinen Augen verschwand und er schließlich leblos auf dem Scheunenboden lag.
Seine Mörder hatten gelacht, mit ihren versifften Flaschen angestoßen. Gott, wie hatte sie gehofft, dass sie sich alle in den Tod saufen würden! Wer weiß, vielleicht stand tatsächlich der eine oder andere morgen nicht mehr auf?
Ihre eigenen Aussichten waren schlecht - solange sie zu gebrauchen war, würden sie sie nicht so schnell töten, da war sie sich sicher. Und retten würde sie auch niemand, denn außer John hatte sie niemanden gehabt. Davon abgesehen wollte sie überhaupt nicht gerettet werden. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie sich selbst mit der Gliederkette erdrosselt, an der sie sie angebunden hatten wie einen Hund. Was mit dem richtigen Hund geschehen war, konnte sie nur erahnen, doch sie wollte es gar nicht wirklich wissen.
Sie wünschte, sie hätte Todesangst, doch es war vielmehr Todessehnsucht, die sie erfüllte.
Anne hatte ihn nicht kommen hören. Wie schaffte ein Betrunkener es, so zu schleichen? Sie zuckte lediglich zusammen, als er beinahe über sie stolperte, und rührte sich nicht, wusste sie doch, was ihr höchstwahrscheinlich blühte. Sie wehrte sich schon lange nicht mehr, es hatte ohnehin keinen Zweck. Sie dachte sich einfach ganz weit weg von all der Demütigung und dem Schmerz. So weit weg sie nur konnte.
Sie wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah, als ihre Hände plötzlich frei von den Fesseln waren. Erst, als das Halsband um ihren Hals verschwand, nahm sie durch ihre zugeschwollenen Augen hindurch langsam etwas von ihrer Umgebung wahr. Als kehre ganz langsam ein Hauch von Leben in sie zurück. Neben ihr war eine Frau, die an ihr zerrte. Anne blinzelte und ließ zu, dass sie auf ihre Beine gehievt wurde. Es war Abigail, die unerschrockene Frau, die sich mit den Männern der Cunningham-Bande herumtrieb. Sie hatte sie ein paar Mal gesehen, wenn sie einen der Männer begleitet hatte, um Futter für die Tiere der Banditen bei John zu holen.
Was tut sie hier?
Es lagen bereits einige Meter hinter ihnen, als Anne plötzlich begriff, dass sie sich vom Ort ihrer Peinigung entfernten. Sie liefen weg. Zum Teufel, es würde ihre Todessehnsucht nicht mildern, doch wenn sie ihre letzten Stunden ohne diese Ausgeburten der Hölle verbringen konnte, dann würde sie alles dafür tun. So gut es ihr geschundener Körper zuließ, lief sie mit Abigail mit. Umständlich und schwerfällig kletterte sie aufs Pferd und war froh, Abigail in der nächsten Sekunde hinter sich zu haben, da sie Angst hatte, vor lauter Schwindel wieder herunterzufallen.
Ihre Retterin ließ keine Zeit verstreichen und spornte das Pferd sogleich zum vollen Galopp an. Anne konnte nicht wirklich gut reiten und ihr Zustand machte es nicht leichter, sich im Sattel zu halten, doch sie klammerte sich mit aller Macht an das Sattelhorn und sah nichts außer der wallenden, flatternden schwarzen Mähne, die ihrem Gesicht oft gefährlich nahe kam. Als sie ein gutes Stück Land hinter sich gelassen hatten, feuerte Abigail drei Schüsse in die Luft, die Anne durch Mark und Bein gingen. Das war ihr Befreiungsschlag.
Peng, peng, peng.
Sie war frei.
Nur, warum fühlte es sich nicht so an?
Benommen glitt Anne vom Pferd in Jacks Arme. Er war das Oberhaupt der Verbrecherbande, zu der Abigail gehörte - und ein guter Mensch, wie John ihr immer gepredigt hatte, wenn er sie besucht oder einen seiner Männer beim Futterholen begleitet hatte. Sie musste wohl in deren Herzstück gelandet sein, in deren Versteck. Doch Anne war es egal, sie nahm auch nichts von der in Dunkelheit getauchten Umgebung wahr. Weder interessierte sie, wo sie war, noch, was mit ihr geschah.
„Um Gottes Willen, Kindchen!“, rief eine ältere Frau und eilte auf sie zu, „los, Francis, hilf mir!“
Ein hagerer Mann eilte herbei und gemeinsam stützten sie Anne, die sich plötzlich einer Ohnmacht nahe fühlte. Ihre Füße gehorchten ihr kaum noch, es kostete sie allerhand Anstrengung sich fortzubewegen. Sie hörte noch vage, wie Jack hinter ihr die Stimme erhob und offensichtlich jemanden zurechtwies, doch sie machte sich keine Gedanken darüber. Der Weg zu ihrem Ziel, einer der hölzernen Hütten, kam ihr vor wie eine Ewigkeit, an die sie sich später nur noch verschwommen erinnerte.
„Setz sie auf den Stuhl“, wies die ältere Frau an, als sie durch die Holztür eingetreten waren.
„Ich glaube, sie wird ohnmächtig, Emily“, stellte der Mann, der Francis hieß, besorgt fest. Mit seiner Hand an ihrer Schulter hielt er sie aufrecht auf dem Stuhl.
„Niemand wird hier ohnmächtig“, sagte Emily nachdrücklich, als könnte sie wahrhaftig darüber bestimmen, und packte Annes Kinn, „sieh mich an, Mädchen. Hast du irgendwelche größeren Verletzungen?“
Größere Verletzungen? Langsam und schwerfällig nahm ihre Iris scharfe Bilder wahr. Vor ihr war das Gesicht einer alten, harten Frau mit freundlichem Blick und grauen Haaren, die sie eindringlich musterte. Anne versuchte gar nicht erst, ein Wort herauszubekommen. Wie sollte jemand sprechen, der nicht mehr da war? Emily schien ihre Lage zu verstehen und akzeptierte ihr Schweigen.
„Hilf mir, sie aufs Bett zu legen.“
Wieder eilte Francis zu Hilfe und sobald die Decke über ihr herabgesunken war, war Anne auch schon eingeschlafen. Sie wachte gefühlt eine Million Mal auf, heimgesucht von furchtbaren Bildern, und wagte es kaum, wieder einzuschlafen. Die eigentlich kurze Nacht schien Ewigkeiten zu dauern und sie fühlte sich kaum besser, als der nächste Morgen erwachte. Sie richtete ihren Blick starr an die Decke, ignorierte die warmen Sonnenstrahlen, die durchs Fenster hereinfielen und ihren seelischen Zustand regelrecht verhöhnten. Von draußen hörte sie die Stimmen der Männer, die beim Frühstück zusammensaßen. Einen kurzen Moment lang bahnte sich die Vorstellung einen Weg in ihre Gedanken, dass es Bills Männer seien. Schmerzlich kniff sie die Augen zusammen und vertrieb das Bild aus ihrem Kopf. Bei all den Erinnerungen, die plötzlich hereinprasselten, musste sie einen Schrei unterdrücken.
Um ihre Sinne zu beschäftigen und so die Geschehnisse für ein paar Minuten zu vergessen, stieg sie aus dem Bett und ging zum Fenster. Draußen sah sie Emily, die an der Pfanne über dem Lagerfeuer hantierte und Tom, einem großen, bärtigen Mann, den Anne bereits von der Farm kannte, auf die Finger klopfte, als er sich einen Happen klauen wollte. Abigail aß bereits, Jack bekam seinen Teller soeben gefüllt. Anne betrachtete das Bild, das sich ihr bot und ihr völlig unwirklich erschien. Hier herrschte soetwas wie Harmonie, friedliche Menschen frühstückten am Lagerfeuer, die Sonne schien – als wäre alles völlig normal.
Plötzlich machte sich Emily auf den Weg zu ihrer Hütte und Anne setzte sich schnell auf den Stuhl, auf dem sie bereits gestern Abend kurz Platz genommen hatte. Mit einem lauten Knarzen öffnete sich die Tür und Emily kam mit einem Lächeln herein.
„Na, Kindchen, hier hast du dein Frühstück.“
Anne erwiderte nichts. Allmählich fragte sie sich, wie sich ihre eigene Stimme überhaupt anhörte und ob sie noch da war? Mit einem kurzen, unzufriedenen Lächeln stellte Emily das Essen auf den Tisch an der Wand, zu dem wohl auch der Stuhl, auf dem Anne saß, gehörte, und sah sie dann musternd an.
„Morgen solltest du rauskommen und mit uns essen.“
„Nein“, krächzte Anne hastig voller Panik und wunderte sich darüber, dass sie einen Ton herausgebracht hatte.
„Ah, du kannst also doch noch sprechen. Deine Zunge haben sie dir wohl gelassen, hm?“
Anne machte große Augen. Emily war nicht allzu oft auf der Farm gewesen und ihre direkte Art schockierte sie regelrecht. Wie konnte sie so einfach darüber sprechen? Was erlaubte sie sich?
Anne fühlte sich gezwungen, mit einer Boshaftigkeit zu kontern: „Sie sitzen dort draußen als wäre nichts. Als wäre es ein völlig normaler Tag. Wie jeder andere.“ Sie legte so viel Abfälligkeit in ihre Stimme wie sie nur konnte und blickte wütend in Richtung Fenster.
„Heute ist ein völlig normaler Tag, wie jeder andere“, sagte Emily unverblümt, sodass Anne sich einen Moment lang fragte, ob ihr überhaupt jemand erzählt hatte, was ihr widerfahren war? Und wenn nicht, konnte man es ihr nicht aus dem geschwollenen Gesicht ablesen?
„Wisst ihr…“
„Keine Angst, Kindchen, ich weiß Bescheid. Und es ändert nichts daran: Heute ist ein völlig normaler Tag, wie jeder andere auch. Und morgen wirst du mit uns frühstücken.“
Mit diesen Worten fiel die Tür hinter ihr ins Schloss und Anne saß da, als hätte sie ein Gespenst gesehen.
Und sie tat es nicht. Lieber starb sie, als sich Emilys Willen zu beugen. Am nächsten Morgen blieb sie stur in ihrer Hütte und abermals brachte Emily ihr das Frühstück. Und auch das Mittagessen. Und jede einzelne Holzmaserung an den Wänden kannte Anne mittlerweile auswendig. In all der Langeweile lief immer und immer wieder derselbe Film vor ihrem geistigen Auge, die immer gleichen, grauenhaften Erinnerungen spielten sich ab. Unaufhörlich. Unglücklicherweise gab es in dieser Hütte keinen einzigen Gegenstand, mit dem sie sich das Leben hätte nehmen können. Hier hatte wohl jemand vorgesorgt. Und hinausgehen zu all den Männern, das wollte sie nicht. So drehte sich der Zeiger der Zeit nur äußerst langsam. Die Ewigkeit ist offensichtlich wahrhaft ewig.
Am späten Nachmittag öffnete sich ihre Hüttentüre erneut. Emily blickte herein.
„Komm mit.“
Anne antwortete nicht, sie hatte nicht vor, irgendwohin zu gehen.
Emily holte Luft: „Es ist keiner da und ich will dir nicht zu nahe treten, aber du solltest dich wirklich waschen.“
Während sie sich auf der einen Seite dachte, dass es keinen Grund für sie gab, sich zu waschen, da sie ohnehin nicht weiterleben wollte, war sie auf der anderen Seite doch tatsächlich beschämt. Erbost blickte sie Emily entgegen, schlang ihre Arme um sich und folgte ihr widerwillig nach draußen. Diese Schlacht hast du gewonnen, alte Frau, aber nicht den Krieg!
Es war ein beklemmendes Gefühl sich im Freien zu befinden. Die ersten Sekunden kam es ihr völlig unwirklich vor, so, als wäre sie in eine Welt gestolpert, in die sie nicht gehörte. Rings um den Feuerplatz, das Zentrum des Verstecks, reihten sich die verlassenen Blockhütten und vermittelten ein Gefühl von Ruhe. Doch auf Anne sprang diese nicht über. Sie warf einen schreckhaften Blick in jeden dunklen Durchgang und jedes dunkle Eck, an dem sie vorbeikamen. Sie war nur froh, dass dieser Ort ringsum von massivem Gestein eingefasst war und sie sich definitiv keine Sorgen über unentdeckte Eindringlinge machen musste. Hier kam niemand ungesehen herein. Die beiden Frauen begaben sich ein gutes Stück abseits der Hütten ans hintere Ende des Verstecks zu einem großzügigen, hölzernen Verschlag.
„Das ist unsere Dusche. Das Wasser hat Jack direkt von einem Bach aus den höheren Lagen abgepumpt. Ich warne dich, es ist eiskalt. Und dass dort Holzwände sind, hast du einzig und allein mir zu verdanken. Ich habe mich eine Ewigkeit geweigert zu duschen, bis Jack endlich diese Wände aufgestellt hat!“ Emily lächelte, drückte ihr saubere Tücher in die Hand und machte sich auf den Rückweg.
Anne wandte sich der Dusche zu, hängte die Tücher griffbereit über eine hölzerne Halterung und trat durch die Tür hinein. Ein rostiger, alter Hahn prangte über ihr und ein großer, ebenso rostiger Hebel, der einen Schwall kalten Wassers versprach, war direkt vor ihr. Alles war bereit. Nur sie nicht. Lange starrte sie den Hebel an, ehe sie schnell tief ein- und ausatmete und sich mechanisch ihres zerrissenen Kleides entledigte. Sie versuchte dabei alle Emotionen zu verdrängen. Starr betätigte sie den Hebel und verzog das Gesicht, als das Eiswasser auf ihre Schultern prasselte. Zuerst fühlte es sich an wie Tausende kleiner Nadelstiche, ehe es erträglich wurde. Ein Stück Seife lag für sie bereit und fahrig säuberte sie ihren geschundenen Leib, ignorierte die vielen Blessuren, die Schrammen, die Schnitte, die von der Seife brannten.
Als sie fertig war, fühlte sie sich unfähig sich zu bewegen. Unablässig prasselte das Wasser auf sie nieder. John war tot. Er war für immer gegangen. Sie würde nie wieder in seinen Armen liegen, seine Küsse spüren, seine Nähe und Wärme genießen. All das war nun vorbei.
Übriggeblieben war nur sie.
Warum? Wofür? Sie wollte dieses Leben nicht.
Nicht mehr.
Ein paar vereinzelte Tränen bahnten sich ihren Weg, doch Anne holte tief Luft, stellte das Wasser ab, griff nach den Tüchern und trocknete sich mit fahrigen, halbherzigen Bewegungen ab. Es gab keinen Grund zu trauern und sich damit auseinanderzusetzen, sie würde dieses Leben nicht mehr lange ertragen müssen.
Als sie sich abgetrocknet hatte, stellte sie erschrocken fest, dass sie ihre alten Klamotten nicht wieder anziehen konnte, doch natürlich hatte sie keine neuen. Sie lugte nach draußen. Es war niemand da. Vielleicht schaffte sie es, eingehüllt in das Tuch zum Abtrocknen, ungesehen in ihre Hütte? Es blieb ihr keine andere Wahl. Fest in das Stück Stoff gewickelt trat sie hinaus und hielt erstaunt inne, als sie etwas Weiches unter ihrem Fuß spürte. Dort lag ein Bündel, offensichtlich für sie. Anne hob es rasch auf und verschwand wieder in der Sicherheit der Holzwände. Sie faltete es auf und sah sich einem schlichten, praktischen Kleid gegenüber. Sie sollte mir keine Kleider schenken. Ich brauche sie nicht, dachte sie missmutig und zog sich an.
Anschließend packte sie alles zusammen und hastete so schnell sie konnte zurück zu ihrer Hütte. Nur niemandem begegnen! Drin wartete Emily bereits auf sie. Anne setzte sich ohne ein Wort auf ihr Bett und fühlte sich nicht wohl in Anwesenheit der älteren Frau.
„Keine Angst, das Kleid ist nur geliehen“, sagte diese, die nebenbei Wäsche zusammenlegte, und nickte dann in Richtung der Tücher, „und deine Wäsche kannst du selber waschen, vermute ich. Scheinst mir alt genug.“ Emily blickte ihr so emotionslos entgegen, als hätte sie soeben nicht das gesagt, was Anne gehört hatte. Schauspielern konnte sie, das musste man ihr lassen.
Verdutzt blickte Anne sie an und beinahe wäre ihre freche Zunge ihr zuvorgekommen, doch sie verkniff es sich. Kein Grund zu streiten. Sie würde niemandem lange zur Last fallen, wenn sie nur einen Weg fand…
Wochen vergingen und der Winter hielt Einzug ins Land. Für Anne stand die Zeit still. Lange brachte Emily ihr dreimal täglich das Essen in ihre Hütte, doch eines Tages hörte sie damit auf.
„Das Verwöhnprogramm ist hiermit beendet. Du holst dir ab morgen dein Essen selbst“, waren ihre Worte gewesen und seither hatte sie sie nicht mehr gesehen. Und das war nun eineinhalb Tage her. Solange hatte Anne es ausgehalten, nichts zu essen. Doch der zweite Tag neigte sich auf Mittag zu und sie sah keinen anderen Weg als ihrem drängenden Magen nachzugeben.
„Gottverdammt“, knurrte sie und stand auf.
Mürrisch ging sie zur Tür, riss sie auf und trat hinaus. In dem Moment, da sie die Schwelle übertrat, war ihre Wut verraucht und sie fühlte sich so klein wie eine Maus, die soeben aus ihrem Loch gehüpft war und sich im Schatten einer übermächtigen Katze wiederfand. Sie spielte mit dem Gedanken, einfach wieder zurückzugehen, doch sie wusste, dass sie es dort allein mit ihrem Hunger nicht mehr lange aushalten würde. Verängstigt blickte sie zur Feuerstelle, wo alle beisammen saßen und zu Mittag aßen.
Es kostete sie mehr Willenskraft als sie glaubte zu besitzen, sich immer und immer wieder zu sagen, dass diese Männer dort unten nicht Bills Männer waren und sie hier in Sicherheit war. Wie ein Mantra wiederholte sie es während sie langsam und zögerlich hinabschritt.
Unten angekommen erwiderte sie keinen der Blicke und hielt den ihren zumeist auf den Boden gerichtet. Sie fragte sich, was sie wohl für ein Bild abgab? Sie wusste nicht, wie schlimm sie wirklich aussah, sie hatte nur eine blasse Ahnung davon. Sie nahm sich eine Schüssel und hielt sie Emily hin, die gerade fertig gewesen war, das Essen zu verteilen. Anne sah sie nicht an, sie wollte nicht sehen, wie sie wieder die Stirn runzelte oder die Augen zusammenkniff.
Doch Emily konnte es offensichtlich nicht bei stiller Ignoranz belassen und sagte schroff: „Gerade noch rechtzeitig. Wir essen alle gemeinsam.“
Statt, dass die alte Schreckschraube froh ist, dass ich überhaupt hier bin und etwas esse, lässt sie einen solchen Spruch los?, dachte Anne wütend, erwiderte jedoch nichts. Emily füllte ihre Schüssel mit einer großen Portion Bohneneintopf und Annes Magen zog sich in freudiger Erwartung zusammen. So schnell sie konnte, ohne zu rennen, hastete sie zurück zu ihrer Hütte und kümmerte sich nicht darum, dass es wohl auch zu Emilys tollen Regeln gehörte, dass sie dort unten bei den anderen bleiben müsste.
Tage vergingen, ehe Anne es wagte in den Spiegel zu blicken. Der Kampf ihrer inneren Dämonen zeigte sich nur allzu deutlich in ihrer zitternden Hand, mit der sie den Spiegel hielt, und ihrem Hadern hineinzublicken. Es ist doch nur eine Kleinigkeit, versuchte sie sich einzureden. Ständig blickten Leute in den Spiegel, jeden Tag. Doch sie musste die Augen schließen und langsam atmen, um ihren Herzschlag zu beruhigen, ehe sie es schließlich wagte.
Was sie sah, ließ sie zusammenfahren. Erschrocken stieß sie die Luft aus und blickte ihrem Antlitz entgegen, als sähe sie eine völlig Unbekannte. Um Himmels Willen, wie musste sie nur nach ihrer Rettung ausgesehen haben, wenn sie nach all den Wochen noch immer Schwellungen und nicht verheilte Schrammen hatte? Ihr rechtes Auge war blutrot angelaufen. Ihre linke Wange war dick, ebenso wie ihr linker Kieferknochen. Sie wandte ihren Kopf nach rechts und verzog schmerzvoll das Gesicht, als sie eine lange Schramme an ihrer linken Wange sah, die wohl dafür verantwortlich war, dass die Schwellung noch immer nicht abgeebbt war. Von ihrem rechten Auge abwärts verlief eine rotleuchtende Narbe bis auf Mundhöhe, die nicht so aussah als würde sie wieder verschwinden. Auch ihren linken Kieferknochen zierte eine große Schramme und was sich sonst noch so an Blessuren in ihrem Gesicht fand, war nahezu unscheinbar dagegen.
Doch was ihr regelrecht den Atem raubte, waren die blauen Flecken und Striemen an ihrem Hals. Das Bild, als John am Morgen nach ihrer Hochzeit ihre Halsbeuge geküsst hatte, flammte vor ihrem geistigen Auge auf. Entgeistert berührte sie die Stelle. Dieser Kuss fühlte sich noch so nah, so real an, als wäre er erst gestern gewesen. Doch was sich ihr im Spiegel bot, war so unendlich weit weg von diesem wunderschönen Moment. Sie mochte sich nur widerwillig ausmalen, wie ihr restlicher Körper aussah, den sie beim Waschen stets so gut sie konnte ignoriert hatte.
Ich sehe aus wie ein Monster.
Der seelische Schmerz drohte sie zu übermannen. Der Kontrast zwischen ihrem friedlichen Leben mit John auf der Farm zu ihrem jetzigen Anblick riss ihr Herz in Fetzen. Eine Flut von Tränen brach aus ihr hervor und jede erdenkliche Gefühlsnuance von Wut, Schmerz und Trauer wirbelte in einem alles zerstörenden Sturm in ihr durcheinander.
Mit einem kratzenden, gläsernen Geräusch zerbarst der Spiegel auf dem Holzboden. Sie wollte sich nicht mehr sehen. Sie wollte sich nie wieder sehen! Ihr Anblick zeigte ihr all das, was sie nicht wahrhaben wollte. Sie fühlte sich wie dieser Spiegel, zerbrochen in Scherben. Sie weinte und schrie und kümmerte sich nicht darum, ob sie jemand hören könnte. Fast die ganze Nacht wand sie sich in Heulkrämpfen auf ihrem Bett, ihre Arme eng um ihren Körper geschlungen, aus Angst, dass sie sonst auch noch die Teile von sich selbst verlor, die ihr geblieben waren.
Am Morgen fielen wieder diese sie verhöhnenden, golden glitzernden Sonnenstrahlen durch das Fenster herein und zeigten ihr unmissverständlich, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte. Doch sie fühlte sich so oder so erschöpft und ausgelaugt. Schlaf hätte nichts an der Leere in ihrem Inneren geändert.
Mit einem schwerfälligen Atemzug rollte sie sich von der Bettseite mit der Holzwand, gegen die sie die halbe Nacht ihren Kopf gepresst hatte, weg, zur offenen Seite hin. Ihr Blick fiel auf den zerbrochenen Spiegel am Boden und sofort beschlich sie die Angst vor ihrem eigenen Anblick und dem, was er beim letzten Mal ausgelöst hatte. Doch sie sah lediglich den Blick aus ihrem unversehrten, grünen Auge, der ihr aus einer der Scherben, die noch groß genug waren, etwas Erkennbares wiederzugeben, entgegenblickte.
Das Einzige an mir, das nicht entstellt ist, dachte sie niedergeschlagen. Ihr wurde klar, dass diese Scherben imstande waren, ihren langersehnten Wunsch zu erfüllen: den Tod. Entgeistert starrte sie sie an, haderte mit sich. Doch sehr, sehr langsam machte sich ein anderes Gefühl in ihr breit. Sie wagte es nicht, es als Kampfesmut zu betiteln, denn sie hatte keine Kraft um zu kämpfen. Doch ihr Todeswunsch war auf Eis gelegt. Eingefroren. Die letzte Nacht hatte etwas verändert.
Noch ist es nicht vorbei mit mir, dachte sie trotzig und hob ihr Kinn. Sie betrachtete ihr unversehrtes, grünes Auge mit neu erwachter Willenskraft und wiederholte ihren Gedanken abermals, doch diesmal hatten dieselben Worte eine völlig andere Bedeutung:
Das Einzige an mir, das nicht entstellt ist.
In den nächsten Tagen kämpfte sie sich so gut sie konnte zurück ins Leben. Sie nahm am Frühstück, Mittag- und Abendessen teil. Von den Männern hielt sie sich fern, sie konnte sich einfach nicht überwinden. Zwar redete sie sich ein, dass niemand von ihnen ihr etwas Böses tun würde, doch sie konnte es einfach nicht glauben, egal, wie sehr sie sich bemühte.
Um Abigail ihre Dankbarkeit für die mehr als waghalsige Rettung mitzuteilen, unterstützte sie sie, so gut sie konnte, denn die junge Frau war schwanger und so fielen ihr die Dinge täglich schwerer. Und sie hörte auf gegen Emily anzukämpfen, erledigte alle Aufgaben, die sie ihr auftrug, ohne Widerrede und versuchte auch hier, sich erkenntlich zu zeigen. Besser spät als nie, so dachte sie sich.
Dann kam der Tag an dem Abigails Kind zur Welt kam. Das ganze Bandenversteck schien den Atem anzuhalten. Jack war am Rande des Wahnsinns und Emily kehrte in letzter Sekunde zurück, um Abby zu helfen. Es vergingen Stunden und ebenso wie die Männer stürzte Anne sich in Arbeit, um ihre Aufregung loszuwerden.
Sie lief gedankenlos mit einem leeren Korb durch das Versteck, nachdem sie Holz für ihren Ofen geholt und diesen beheizt hatte. Der Schnee war schon völlig niedergetrampelt von den vielen aufgescheuchten Männern - und Anne - die den Nachmittag und Abend panisch auf und ab gerannt waren. Gerade, als Anne zu ihrer Hütte abbog, hielt eine Stimme sie auf.
„Anne!“
Sie wandte sich um und sah eine erschöpfte und zufriedene Emily aus Abigails Hütte kommen.
„Geht es Abigail gut? Und dem Kind?“, bestürmte Anne sie sofort, während sie auf sie zurannte.
„Ein munteres kleines Kerlchen und eine zutiefst erschöpfte, aber glückliche Mutter“, grinste Emily und deutete auf das Lagerfeuer, „los, setz dich zu mir.“
Unbehagen beschlich Anne. Menschliche Nähe versetzte sie in Panik. Doch sie riss sich zusammen und nahm neben Emily am Lagerfeuer auf einem der Holzstämme Platz. Es folgte ein Gewusel an nervösen Männern, die alle nach und nach Emily entdeckten und aussahen als würde ihnen je eine Tonne Steine von ihren Schultern fallen, sobald sie hörten, dass es Abby und dem Kind gut ging. Es war rührend!
Dann irgendwann kehrte Ruhe ein und Anne stellte fest, dass Emily sehr müde aussah. Sie würde sicher bald zu Bett gehen, zumindest sollte sie das.
„Ich möchte deine Hütte nicht länger belegen, Emily.“
„Das hört sich gut an, ich habe es satt, mir Francis‘ Geschnarche anzuhören.“
Anne riss erschrocken die Augen auf, als ihr die Konsequenzen ihrer Aussage bewusst wurden. Es gab keine freie Hütte, sie würde also bei einem der Männer einziehen müssen, wenn Emily ihre Hütte zurücknahm. Das hatte sie in ihrer „Großzügigkeit“ nicht bedacht!
„Schau nicht so als hättest du einen Geist gesehen. Meine Hütte ist groß genug für uns beide. Nur mein Bett nicht“, lächelte Emily.
„Ich schlafe auf dem Boden, das ist kein Problem. Ich habe mein halbes Leben auf dem Boden geschlafen.“
„Francis wird sich dreimal bekreuzigen, wenn er sein Bett wieder hat!“
Emily fragte nicht weiter nach – Emily fragte nie nach. Sie hatte Anne auch kein einziges Mal zu ihren Erlebnissen befragt, ganz zu schweigen vom Leben vor ihrer Heirat. Emily hatte Anne von ihren seelischen Wunden geheilt, ohne je mit ihr über die selbigen gesprochen zu haben.
In der folgenden Stille verspürte Anne den Drang, Emily ihre Gefühle auszudrücken. Es war so viel passiert und auch wenn sie durch ihre Mithilfe sicherlich deutlich zeigte, dass sie dankbar war, so war da doch noch Unausgesprochenes zwischen ihnen. Es kostete sie unglaubliche Überwindung, die Worte hervorzuzwingen und das längst nötige Gespräch damit ins Rollen zu bringen.
„Woher wusstest du, dass deine harte Tour bei mir funktionieren würde?“
Emily lächelte frech und sah für einen Moment aus wie ein junges Mädchen. Sie wusste sofort, worum es ging. „Hätte ich dich bemitleidet, wärst du versunken. Indem ich dich ab und an pikiert habe, hab ich dich aus der Reserve gelockt. Ich hab dir nicht den Hauch einer Chance gegeben, dich in deinem Schneckenhaus zu verkriechen.“
„Nein, das hast du wahrlich nicht“, bestätigte Anne und konnte ein Glucksen nicht vermeiden bei der Erinnerung. Im Nachhinein sah sie ganz klar, wie Emily sie Stück für Stück auf ihrem Weg voran geschubst hatte.
„Es hätte aber auch schiefgehen können“, überlegte sie.
Doch Emily schüttelte überzeugt den Kopf: „Der Hunger hat sie noch alle wieder zur Besinnung gebracht.“
Anne lächelte im Schein der Flammen und konnte sich nur wundern über das Geschick und die Intelligenz dieser Frau.
Sie nahm all ihren Mut zusammen: „Du hast mir das Leben gerettet, Emily. Mindestens genauso sehr wie Abigail es tat.“
Anne glaubte ein Lächeln über Emilys Lippen huschen zu sehen, war sich allerdings nicht sicher.
„Na los, lass uns zu Bett gehen und dem armen Francis die frohe Botschaft verkünden“, sagte die alte Frau.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com